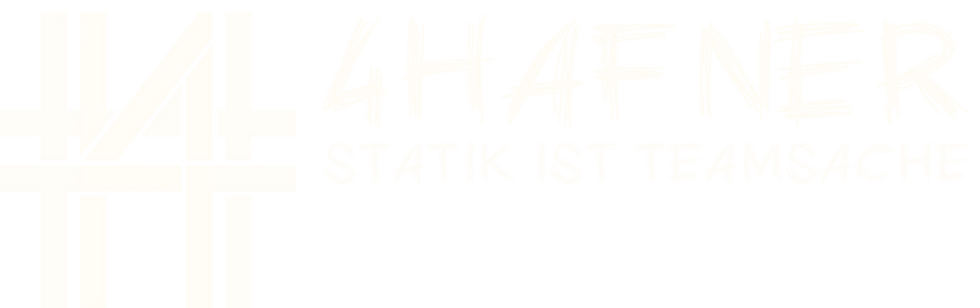Statikus erklärt die Welt im Vermessungsamt Rosenheim:
- 21. Okt. 2025
- 3 Min. Lesezeit
Sanierung im Denkmal – Warum das so knifflig ist
Stellt euch vor, ihr habt ein altes, prachtvolles Gebäude. Es erzählt Geschichten aus längst vergangenen Zeiten – doch nun muss es saniert werden: Risse ziehen sich durch die Wände, Balken verlieren an Tragkraft oder moderne Technik fehlt. Klingt nach einem spannenden Projekt? Absolut! Aber es ist auch eine echte Herausforderung.
Denn die Sanierung eines Denkmals unterscheidet sich deutlich von einer „normalen“ Sanierung. Hier darf man nicht einfach alte Bauteile austauschen und Neues einbauen. Stattdessen gilt: behutsam ertüchtigen, sorgfältig planen und eng mit dem Denkmalschutz zusammenarbeiten.
Warum ist das so kompliziert?

Bei einer Denkmalsanierung müssen viele Interessen unter einen Hut gebracht werden:
Denkmalschutz: möchte die historisch wertvolle Substanz erhalten und bewahren.
Tragwerksplaner: sorgen dafür, dass das Gebäude sicher und stabil bleibt.
Brandschutzexperten: achten darauf, dass Menschen im Ernstfall geschützt sind.
Haustechniker: bringen Strom, Wasser und Heizung auf den neuesten Stand.
Wärme- und Feuchteschutz: stellt sicher, dass das Gebäude angenehm bewohnbar bleibt.
Jede dieser Fachrichtungen bringt eigene Anforderungen mit – und oft stehen sie sogar im Widerspruch zueinander. Genau das macht die Arbeit anspruchsvoll, aber auch spannend, denn es entstehen komplexe und kreative Lösungsansätze.
Typische Stolpersteine in der Praxis

Tragwerk:
Historische Bauwerke weisen häufig erhebliche Schäden an der Konstruktion auf – vor allem an Holzbauteilen, die durch Feuchtigkeit, Pilzbefall oder Insekten geschwächt wurden. Auch frühere Umbauten, die nicht fachgerecht ausgeführt wurden, können deutliche Schäden hinterlassen.
Kommt eine neue Nutzung hinzu, entstehen durch moderne Bauteilaufbauten zusätzliche Lasten. Diese müssen statisch berücksichtigt und die betroffenen Bauteile gegebenenfalls verstärkt oder ertüchtigt werden. Die historischen Konstruktionen wirken aus heutiger Sicht oft kompliziert – hier braucht es Ingenieure mit Erfahrung in alten Bauweisen.
Brandschutz:
Ein Denkmal soll sicher sein, ohne seinen historischen Charakter zu verlieren. Bauteile müssen nachweisen, dass sie im Brandfall ausreichend lang standhalten – was bei vielen historischen Querschnitten nicht der Fall ist. Zusätzliche Technik wie Sprinkleranlagen oder Brandschutzplatten darf jedoch nicht sichtbar sein, um das originale Erscheinungsbild zu bewahren.
Wärme- und Feuchteschutz:

Fassaden dürfen meist nicht von außen gedämmt werden, da sich das Erscheinungsbild sonst verändern würde. Auch Fenster sind oft kunstvoll gefertigt, ein Austausch daher kaum möglich. Gefragt sind daher kreative Lösungen, die energetisch wirksam, aber optisch unauffällig bleiben.
Haustechnik:
Stromleitungen, Heizungs- oder Lüftungsanlagen müssen integriert werden – möglichst so, dass sie kaum sichtbar sind. Gerade in massivem, historischem Mauerwerk ist das oft eine echte Tüftelei.
Warum Erfahrung hier Gold wert ist
Bei einer Denkmalsanierung steht und fällt vieles mit den richtigen Fachleuten:
Handwerker mit Spezialwissen, die alte Materialien und Techniken beherrschen.
Tragwerksplaner, die historische Holzverbindungen und Mauerwerksstrukturen beurteilen können und realistische Berechnungen anstellen.
Prüfingenieure, die mit Erfahrung einschätzen, ob ein geplantes statisches System auch wirklich plausibel ist.
Fehlt dieses Know-how, kann es schnell teuer werden – weil Planungen angepasst oder im schlimmsten Fall vollständig überarbeitet werden müssen.
Der richtige Ablauf – Schritt für Schritt

Damit alles Hand und Fuß hat, läuft eine Denkmalsanierung in klaren Phasen ab:
Aufmaß
Zuerst wird das Gebäude genau vermessen. Alle Abmessungen, Höhen und auch bestehende Verformungen werden dokumentiert. Nur so weiß man, worauf man aufbaut.
Schadenskartierung
Wenn die Konstruktion freigelegt ist, wird der Zustand genau untersucht: Wo gibt es Schäden? Welche Materialien wurden tatsächlich verbaut? Oft kommt hier Überraschendes ans Licht.
Planung
Auf Basis dieser Erkenntnisse wird geplant. Ohne die vorherigen Schritte wäre das wie Rätselraten – mit der Gefahr, dass später teure Nachbesserungen nötig werden.

Zusammengefasst: Eine Sanierung im Denkmal ist immer ein Balanceakt: Wir wollen Geschichte erhalten – und gleichzeitig ein sicheres, nutzbares Gebäude schaffen, das heutigen Standards entspricht.
Das bedeutet: viel Geduld, eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und Fachwissen, das weit über den normalen Baualltag hinausgeht. Doch am Ende lohnt es sich: Denn so bleiben unsere historischen Schätze nicht nur erhalten, sondern bekommen auch eine Zukunft.